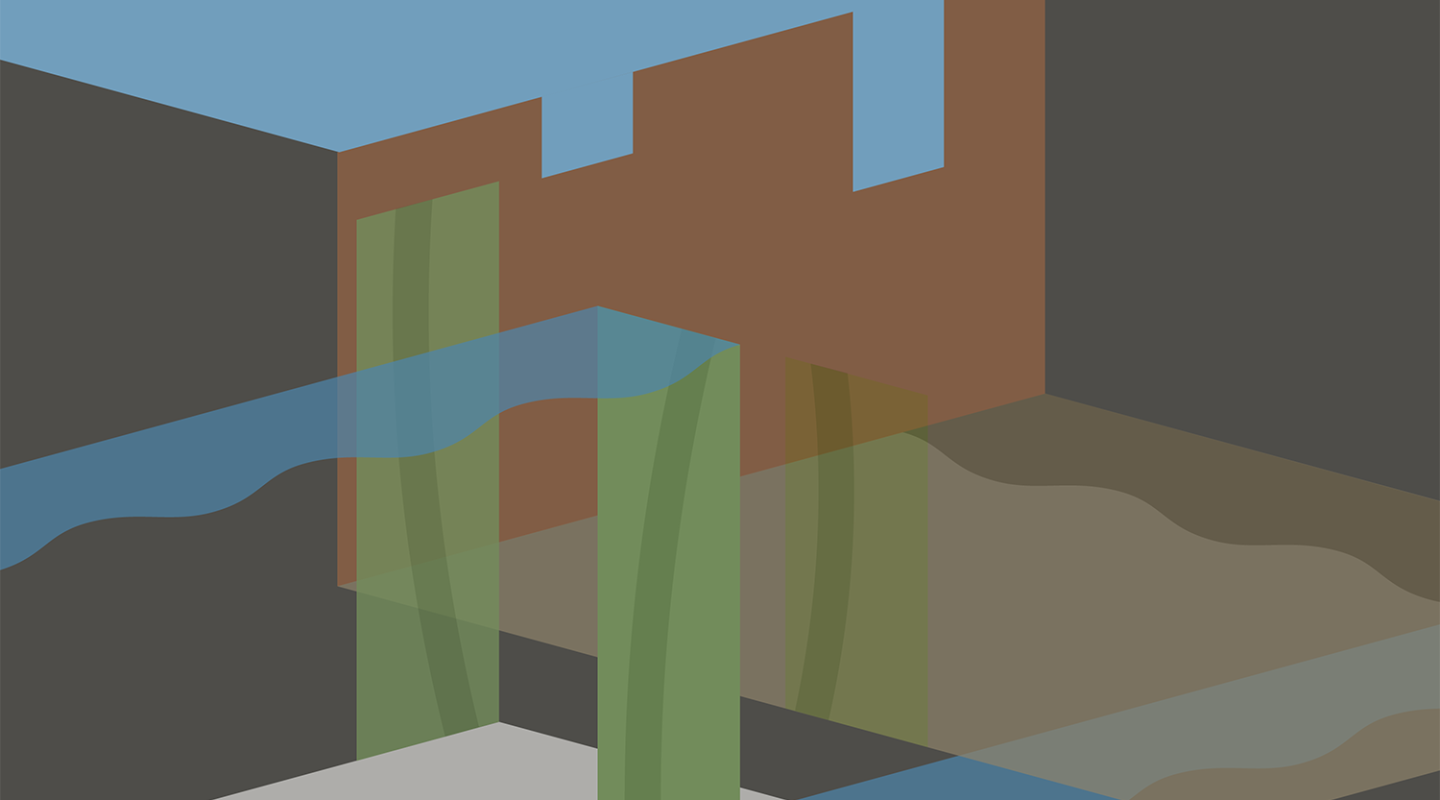Einleitung
Wir alle leben in dieser Welt, doch die Welt lebt auch durch uns. So wie unser Lebensraum durch unser Handeln, unser Streben nach Macht und den Lauf der Zeit geformt wird, so werden auch wir kontinuierlich durch ihn geprägt. Diese komplexe Beziehung zwischen Mensch und Natur steht im Mittelpunkt der Ausstellung und wird durch das Prisma der Landschaften betrachtet.
Land in Motion erstreckt sich über zwei Etagen und präsentiert eine Auswahl von Objekten aus den Bereichen Archäologie, Geschichte und Kunst. Die Exponate demonstrieren selektiv die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Anhand der vier Themenbereiche Wald, Fluss, Landwirtschaft und Industrie werden die Besucherinnen und Besucher angeregt, ihren eigenen Platz in der Geschichte zu hinterfragen bzw. ihn aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Die ausgestellten Objekte vermitteln ein Bewusstsein dafür, wie sich Menschen und Natur gegenseitig wahrgenommen, geformt, bereichert, aber mitunter auch geschadet haben. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart lädt Land in Motion dazu ein, sowohl über unser ökologisches Erbe als auch über die Welt, die wir hinterlassen, nachzudenken.
- Die Landschaft in der westlichen Kunst: In der westlichen Kunst wurden Landschaften zunächst als Hintergrund für religiöse und mythologische Szenen dargestellt. Erst im 16. Jahrhundert entwickelte sich die Landschaftsmalerei unter dem Einfluss der flämischen und niederländischen Kunst zu einem eigenständigen Genre. Ende des 18. Jahrhunderts markierte die Romantik einen Wendepunkt: Malerinnen und Maler begannen, die persönliche und emotionale Wahrnehmung der Natur in den Vordergrund zu stellen. Oft portraitierten sie einsame Figuren in weiten, kontemplativen Landschaften, die Selbstbesinnung und eine spirituelle Verbindung zur Natur symbolisierten. Die Künstlerinnen und Künstler gingen dabei über die rein visuelle Darstellung hinaus und versuchten, tiefere Bedeutungen zu vermitteln. Dieser Ansatz besteht bis heute fort. Im 19. Jahrhundert wurden Landschaftsdarstellungen darüber hinaus zu einem Ausdruck des Nationalstolzes und führten zur Herausbildung sogenannter „nationaler Landschaften“. Sie trugen zur Identitätsbildung eines Landes bei und förderten das Bewusstsein für ein gemeinsames Erbe. In der zeitgenössischen Kunst variieren Landschaften je nach Kunstform erheblich und spiegeln unterschiedliche Perspektiven und Umweltaspekte wider.
- Begriffsdefinition: Sowohl im Französischen als auch im Englischen ist der Begriff „paysage“ bzw. „landscape“ für Landschaft nicht auf die Kunst beschränkt, taucht aber dort zum ersten Mal auf. Ursprünglich bezeichnete er Gemälde der niederländischen Kunst des 16. Jahrhunderts, die Naturlandschaften darstellten. Die Wahrnehmung einer Landschaft wird durch den Betrachtenden bestimmt, einerseits durch den Ausschnitt der Realität, den er vor Augen hat, andererseits durch die Aufmerksamkeit, die er bestimmten Aspekten dieses begrenzten Raums schenkt. So galten Fabriken und ihre rauchenden Schornsteine vor einem Jahrhundert als Zeichen des menschlichen Fortschritts. Heute sehen wir in ihnen den Ausdruck eines zerstörerischen Kapitalismus. Der Begriff umfasst daher heute sowohl die visuellen als auch die ökologischen Aspekte einer Umgebung und spiegelt die Verbindung zwischen Natur und menschlicher Aktivität wider.
- Die Landschaft unserer Region: Vor etwa 300 Millionen Jahren erhoben sich die Gebirgszüge unserer Regionen aus dem Meer und es entstanden Wälder. Während der Eiszeit formten intensive Frost- und Tauzyklen die Täler. Im Laufe der Zeit erodierten Flüsse wie Mosel, Sauer und Alzette das Gelände weiter und gaben ihm seine heutige Form. Als vor 7.500 Jahren die ersten menschlichen Siedlungen entstanden, veränderte sich die Landschaft allmählich durch Ackerbau und Viehzucht. Zuweilen holte sich die Natur diese Flächen jedoch wieder zurück und die Wälder breiteten sich erneut aus, insbesondere während des Bevölkerungsrückgangs nach den Pestepidemien im Europa des 14. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert führte die industrielle Revolution mit ihrer starken Mechanisierung der Arbeit zu einer erneuten tiefgreifenden Veränderung der Landschaft. In den letzten Jahrzehnten haben die Urbanisierung und die damit einhergehende Verdichtung der städtischen Ballungsräume ländliche Regionen und ehemalige Industriegebiete radikal verändert.
- Das Anthropozän: Die Interaktionen des Menschen mit der Landschaft haben ihren einstigen symbiotischen Charakter verloren und sich zu einer von erheblichen Veränderungen geprägten Beziehung gewandelt. Die Menschen haben sich zunehmend von einem Leben im Einklang mit den Rhythmen der Natur entfernt. Mit dem Aufkommen der Landwirtschaft, der Industrialisierung und der Urbanisierung begannen sie, die Landschaft nach ihren Bedürfnissen und Interessen zu gestalten. Der Begriff „Anthropozän” (von altgriechisch ánthropos = „Mensch” und kainós = „neu”) bezeichnet dieses neue geologische Zeitalter, in dem die zunehmenden menschlichen Aktivitäten zu einer dominierenden Kraft bei der Veränderung der Ökosysteme, des Klimas und der natürlichen Prozesse unseres Planeten geworden sind.
Waldlandschaften
Der Wald wird oft als die symbolträchtigste Naturlandschaft unserer Region angesehen. Seine dichte Vegetation und Weitläufigkeit bilden einen starken Kontrast zu den vom Menschen genutzten Flächen. Im Laufe der Zeit hat sich die Waldlandschaft unter dem Einfluss menschlicher Aktivitäten und des Klimawandels verändert. Am Ende der letzten Eiszeit (um 11.700 v. Chr.) wuchsen auf dem Gebiet des heutigen Luxemburgs von Natur aus Kiefern-, Birken- und Eichenwälder. Mit dem Aufkommen der Landwirtschaft in der Jungsteinzeit (zwischen 5500 und 2300 v. Chr. in Europa) wurde jedoch nach und nach Land gerodet, um Platz für den Ackerbau zu schaffen. Als die Römer im 1. Jahrhundert n. Chr. das Gebiet besetzten, waren zwei Drittel des heutigen Großherzogtums mit Wald bedeckt. Zu Beginn des Mittelalters bestand nur noch die Hälfte des Territoriums aus Wäldern. Heute beträgt der Anteil nur noch ein Drittel. Bereits im 16. Jahrhundert kam in Europa die Sorge auf, dass die Wälder verschwinden könnten. So äußerte schon 1585 der Gouverneur Mansfeld die Befürchtung, dass der vor den Toren der Stadt Luxemburg gelegene Grünewald in naher Zukunft verschwinden könnte.
Obwohl die Wälder überlebt haben, haben sie erhebliche Veränderungen durchlaufen. Seit jeher haben die Menschen dort gejagt, Nahrungsmittel gesammelt und sich die übrigen Ressourcen des Waldes zunutze gemacht. Sie fällten beispielsweise Holz, das ihnen als Brennstoff, Baumaterial und für handwerkliche Zwecke diente. Die Folgen des menschlichen Wirkens sind vielfältig: eine geringere Vegetationsdichte, Bodenschäden durch die Einführung bestimmter Pflanzenarten und große Bauprojekte, ein Ungleichgewicht in der Tierwelt und nicht zuletzt die Erderwärmung.
Sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Kunst werden Waldlandschaften oft idealisiert dargestellt. So interpretierte beispielsweise der Landschaftsmaler Barend Cornelis Koekkoek Naturlandschaften neu und verlieh ihnen romantisierende ästhetische Züge. Während ein dicht bewachsener Wald einerseits ein Gefühl der Geborgenheit und inneren Ruhe vermitteln kann, wird er andererseits, insbesondere angesichts zahlreicher Kindermärchen mit wilden Tieren, manchmal auch als gefährliche Umgebung wahrgenommen.
Die sich wandelnden Vorstellungen werden von Künstlerinnen und Künstlern aufgegriffen, die sich seit jeher mit den komplexen Machtverhältnissen zwischen Mensch und Natur auseinandersetzen. Mit ihrem feinfühligen und bewussten Blick auf die Umwelt tragen sie ihrerseits aktiv zum Engagement für den Erhalt der Naturräume bei.
Agrarlandschaften
Das Aufkommen der Landwirtschaft in der Jungsteinzeit um 5.500 v. Chr. markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit und unserer Umwelt. Die Landwirtschaft veränderte die Naturlandschaften grundlegend und unwiderruflich: Wälder wurden gerodet, Landstriche urbar gemacht und Felder angelegt. Ein anschauliches Beispiel dafür in unserer Region ist das neolithische Dorf Remerschen. Auch wenn diese ländlichen Gebiete auf den ersten Blick natürlich erscheinen, sind sie doch das Ergebnis jahrhundertelanger menschlicher Eingriffe.
Das Erscheinungsbild der hiesigen Felder hat sich im Zuge der technologischen Entwicklungen kontinuierlich gewandelt. Bereits zur gallischen Zeit beschleunigte der Einsatz des Vallus, einer innovativen Erntemaschine, die zuvor mit der Sichel ausgeführte Erntearbeit. Auch landwirtschaftliche Praktiken wie die Brachlegung von Feldern, um dem Boden eine Ruhepause zu verschaffen und eine anschließende Beweidung zu ermöglichen, oder die Einführung neuer Kulturpflanzen wie der Kartoffel im 18. Jahrhundert trugen zur Veränderung der Landschaft bei. Im 20. Jahrhundert wirkte sich die Mechanisierung der Landwirtschaft erheblich auf die landschaftliche Struktur aus: Betriebe und Parzellen wurden größer, die meisten Sumpfgebiete wurden trockengelegt und Hecken sowie Waldflächen verschwanden zugunsten von Monokulturen. Die intensive Landwirtschaft führte zu einer Vereinheitlichung des Landschaftsbildes und bedrohte die Artenvielfalt. Die landwirtschaftlichen Flächen wurden anfälliger und zunehmend abhängig von Chemikalien, die wiederum das Grundwasser verschmutzten und unsere Gesundheit sowie die unseres Planeten beeinträchtigten. Seit einigen Jahrzehnten hat das wachsende Bewusstsein für diese Umweltrisiken zu nachhaltigeren Bewirtschaftungsmethoden geführt.
Seit jeher dienen all diese Entwicklungen Künstlerinnen und Künstlern als Inspirationsquelle. In der Antike stand die Landwirtschaft für Überleben und Fruchtbarkeit. Der jährliche Zyklus der Natur, von der Saat bis zur Ernte, wurde als Ausdruck göttlicher Kräfte angesehen. Mit zunehmender Beachtung der Lebensrealität der einfachen Bevölkerung in der Gesellschaft entstanden idealisierte und kritische Darstellungen der landwirtschaftlichen Arbeit. Ab dem 20. Jahrhundert begannen Künstlerinnen und Künstler, die Spannungen zwischen traditioneller Landwirtschaft und industriellem Fortschritt zu thematisieren. Inzwischen ist ihre Perspektive globaler und noch kritischer geworden. Die Agrarwirtschaft ist zweifellos zu einem Symbol für umfassendere gesellschaftliche Veränderungen geworden, die das Kräfteverhältnis zwischen Mensch und Umwelt widerspiegeln.
Flusslandschaften
Die erste Strophe der luxemburgischen Nationalhymne ist ein Lobgesang auf die Flusslandschaften: Wou d'Uelzecht durech d'Wisen zéit, duerch d'Fielsen d'Sauer brécht. Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit, den Himmel Wäin ons mécht... („Wo die Alzette durch die Wiesen zieht, durch die Felsen die Sauer bricht; die Rebe längs der Mosel blüht, der Himmel Wein verspricht...”). Diese Verse unterstreichen die tiefe Verbundenheit der luxemburgischen Bevölkerung mit den von Flüssen geprägten Landschaften.
Die Beziehung zwischen Mensch und Fluss ist so alt wie die Menschheit selbst, denn alles menschliche Leben hat sich stets in der Nähe von Wasser entwickelt. Alle Zivilisationen waren und sind von dieser lebenswichtigen Ressource abhängig, nicht nur zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse wie die Versorgung mit Trinkwasser und die Körperhygiene, sondern auch für zahlreiche Tätigkeiten wie Landwirtschaft, Handwerk, Lederverarbeitung, Keramikherstellung, Langstreckentransporte oder den Betrieb von Mühlen und Staudämmen.
Auch Bäche, Flüsse und Ströme wurden durch den Einfluss des Menschen nachhaltig verändert. An ihren Ufern errichtete er Städte, Brücken, Aquädukte und Häfen. Viele Flüsse wurden kanalisiert und somit aus ihrer natürlichen Umgebung herausgenommen. Diese Eingriffe führten zu Umweltverschmutzung und vermehrten Überschwemmungen mit verheerenden Folgen. Heute gibt es immer mehr Renaturierungsinitiativen, die den Flüssen ihr natürliches Bett zurückgeben sollen. Vor einigen Jahren wurde damit begonnen, die schmale Petruss, die durch die Stadt Luxemburg fließt, aus ihrem Betonkorsett zu befreien.
Die Flusslandschaft ist seit jeher ein genreübergreifendes Thema in der Kunst. In seinem um 370 n. Chr. verfassten Werk Mosella besingt der römische Dichter Ausonius die wichtigsten Flüsse unseres Landes: die Mosel, die Sauer und die Alzette. Die bildende Kunst versucht, die einzigartigen Eigenschaften des Wassers einzufangen, wobei sie sich sowohl vom alltäglichen Gebrauch als auch von mythologischen und spirituellen Assoziationen inspirieren lässt. In verschiedenen Kulturen und Epochen wurden Flüsse oft vergöttert und als heilig dargestellt. Dies spiegelt sich in ihren vielfältigen Darstellungen wider und setzt sich bis in die Gegenwart fort.
Industrielandschaften
Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und der technologische Fortschritt, der neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnete, führten zur Entstehung neuer Landschaftsformen. Mit dem Aufkommen großer Fabrikanlagen gewann die Transformation der Landschaft eine neue Dimension. In Luxemburg war hierfür insbesondere die Stahlindustrie verantwortlich. Auf dem Titelberg reichen die ersten Spuren des Eisenerzabbaus mehr als 2000 Jahre zurück. Die Einführung von Maschinen, wie der Dampfmaschine, im 19. Jahrhundert markierte einen wichtigen Wendepunkt. Sie führte zu einem enormen Aufschwung der Stahlindustrie in Luxemburg. Mit der ersten industriellen Revolution hielten neue technologische Errungenschaften wie Hochöfen mit rauchenden Schornsteinen, Gasometer und Staudämme in den Abbaustätten Einzug und prägten fortan das Landschaftsbild.
Diese Innovationen symbolisierten den Fortschritt und wurden in den künstlerischen Darstellungen jener Zeit häufig verherrlicht. Die aus ihnen resultierenden ökologischen und sozialen Schäden waren jedoch nicht zu übersehen. Einige künstlerische Strömungen, wie der Realismus, griffen diese Aspekte auf und thematisierten ihre Schattenseiten. Andere Künstlerinitiativen setzten sich hingegen für eine Annäherung zwischen Mensch und Natur ein.
Die negativen Auswirkungen der Industrialisierung, insbesondere die Bodenverschmutzung und der Klimawandel, sind nach wie vor präsent und werden die Umwelt auch in Zukunft noch weiter verändern. Der Niedergang bestimmter Industriezweige hat jedoch auch Brachflächen hinterlassen, von denen einige einer neuen Nutzung zugeführt wurden. So wurde beispielsweise das ehemalige Fabrikgelände von Belval in der Minette-Region (Terres Rouges) zu einem neuen Stadtviertel umgestaltet. Andere Standorte wurden zu Naturschutzgebieten erklärt.